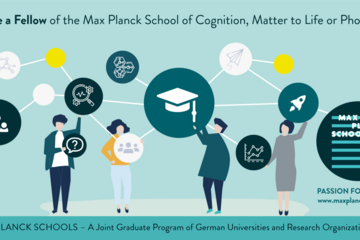„Mit Neugier zu neuem Wissen beitragen“
Interview mit der Clinician Scientist Program Kandidatin Anne Felsenheimer
Die Medizinerin Anne Felsenheimer startete Ende 2022 als eine der ersten Kandidatinnen im neuartigen Clinician Scientist Programm (CSP) der Max Planck School of Cognition (MPS Cognition). Das Programm adressiert ambitionierte Mediziner:innen in frühen Karrierestufen, die klinische Weiterbildung mit exzellenter Forschung in den Bereichen Psychiatrie und (kognitive) Neurologie verbinden und sich im Rahmen eines einzigartigen Netzwerks herausragender Wissenschaftler:innen weiter qualifizieren möchten. Im vergangenen Jahr wurde Anne von der ZEIT als Zia-„Visible Women in Science" benannt.
Grund genug, mit ihr über ihre Motivation für das CSP der MPS Cognition und ihre Ambitionen für die Zukunft zu sprechen:

Anne, Dein bisheriger Lebenslauf liest sich beeindruckend: Du hast mehrere Studiengänge erfolgreich absolviert, warst für Forschungsaufenthalte u. a. in Nashville, als Speakerin bei Falling Walls und bist seit Herbst Doktorandin der MPS Cognition. Was waren Deine Beweggründe, Dich für das Programm zu bewerben?
Den bestmöglichen Weg in die Forschung vorzubereiten. Es war lange nicht klar, dass ich überhaupt in die Forschung möchte – im Gegenteil, nach meinem Bachelor in Psychologie habe ich ein Medizinstudium begonnen, um klinisch tätige Psychiaterin zu werden. Ich war jedoch schon immer über die Disziplinen hinweg interessiert. Die Forschung ist eines der wenigen Arbeitsfelder, die diese Interdisziplinarität ermöglicht. Es bietet die besten Möglichkeiten, interdisziplinär zu arbeiten und dadurch mein Wissen aus den einzelnen Studiengängen einzubringen. Ein weiterer Beweggrund für die Arbeit in der Forschung ist, dass ich mit meiner Neugier und eigener Perspektive zu neuem Wissen beitragen kann.
Kannst Du kurz beschreiben, womit sich Deine Forschung beschäftigt?
Was ist Dein Ziel?
In meiner Forschung ist es mir insbesondere ein Anliegen, verschiedene Disziplinen und Blickwinkel auf psychiatrische Erkrankungen zu integrieren. Ein Beispiel dafür ist die Kombination von Linguistik und Psychopathologie, bei der ich mich mit dem Verstehen von Ironie und Metaphern bei Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Schizophrenie auseinandersetze. Ein weiteres Beispiel ist die Betrachtung der Interaktion von Körper und Geist. Diese beeinflusst nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern kann auch erklären, warum bestimmte Personen deshalb eine andere Wahrnehmung haben. Mein Ziel ist es dabei, einen erklärenden Blickwinkel einzunehmen. Statt zu fragen: Was funktioniert nicht? Möchte ich herausfinden: Wie wie wird es wahrgenommen und warum?
Das stark interdisziplinäre Clinician Scientist Program richtet sich vornehmlich an junge Mediziner:innen, die langfristig in der Forschung arbeiten bzw. ihre Fähigkeiten in diesem Bereich ausbauen wollen. Was macht das Programm aus Deiner Sicht so besonders und wo siehst du hier konkrete Vorteile?
Die medizinische Doktorarbeit wird meist während des Studiums durchgeführt, ist unbezahlt und das Studium fokussiert sich eher auf die praktische Anwendung als auf das wissenschaftliche Arbeiten. Durch diese Platzierung des Dr.med. leidet notwendigerweise auch die wissenschaftliche Qualität und Tiefe. Das interdisziplinäre Clinician Scientist Program ist daher gerade für Mediziner:innen, die zusätzlich wissenschaftlich arbeiten wollen, attraktiv – und bringt die klinische Praxis in die Forschung.
Du befindest Dich derzeit in Deiner dritten, so genannten lab rotation – eine Art Forschungshospitation an unterschiedlichen Standorten des breit gefächerten Partner-Netzwerks der Schools. Welche Erfahrungen nimmst Du hieraus mit?
Werner Heisenberg hat einmal gesagt „Was wir beobachten, ist nicht die Natur selbst, sondern die Natur, die unserer Methode der Befragung ausgesetzt ist“ - jede Arbeitsgruppe hat ihre eigene Methodik und Theorie, um die menschliche Kognition zu verstehen, und es fasziniert mich, wie sich ein und demselben Thema von ganz unterschiedlichen Perspektiven angenähert werden kann. Die Rotationen geben dadurch nicht nur spannende Ideen für meine eigene Forschung, sondern zeigen mir auch auf, was ich bei der Wahl meiner Methodik bedenken muss.
Hast Du konkrete Vorstellungen davon, wie sich die nächsten Jahre entwickeln könnten oder vielmehr, was wünscht Du Dir für die Zukunft?
Bisher bin ich sehr glücklich damit, wie die nächsten Jahre aussehen werden – der PhD bietet mir viele interessante Möglichkeiten. Ich freue mich darauf, immer wieder neue Themen und Methoden zu lernen, mich mit so vielen spannenden Wissenschaftler:innen auszutauschen. In der Zukunft würde ich gerne weiterhin in einem interdisziplinären und internationalen Umfeld arbeiten.
Im vergangenen Jahr wurdest Du als eine von 25 Wissenschaftlerinnen für das neue ZEIT Programm Zia – Visible Women in Science ausgewählt. Was bedeutet diese Auszeichnung für dich und hat sich dadurch etwas verändert?
Seit dem Programm überdenke ich zunehmend meine Rolle und die Verantwortung, die jede:r selbst für eine veränderte Zukunft hat. Während meines Abiturs waren mir die impliziten Effekte von sozialer Herkunft und Geschlecht nicht bewusst, und ich dachte, die Chancen basieren lediglich auf Talent und Leistung. Mit der Universität merkte ich zum ersten Mal, dass es auch die Kleidung, die Weinkenntnis, die Aussprache – kurzum, ein bestimmter Habitus ist, der ganz unabhängig von Talent und Leistung Entscheidungen trifft. Besonders nach dem Studium wurden mir die zusätzlich fehlenden Privilegien als Frau bewusst. Es sind immer noch überwiegend Männer, die als Entscheidungsträger an der Spitze der Politik – und auch der Wissenschaftspolitik – und in Universitäten stehen. Insbesondere durch Zia habe ich erkannt, dass es für den Abbau dieser Ungleichheit vor allem Sichtbarkeit verlangt. Eine Frau und eine Erstakademikerin auf Internetseiten der Institute und Universitäten macht es für andere, die in der gleichen Situation sind, wesentlich vorstellbarer, diese Tätigkeit auch auszuüben und sich auch zu bewerben.
Hast Du eine Art Vorbild oder eine:n Mentor:in, der/die Dich inspiriert oder auf deinem Weg begleitet?
Mentor:innen sind unglaublich wichtig. Für mich sind es enge Freund:innen und andere Wissenschaftler:innen, die mich inspirieren und unterstützen. Von der Frage nach einem Vorbild war ich jedoch früher eingeschüchtert, da sie immer auch eine bestimmte intellektuelle Darstellung mit sich bringt. Zum einen, weil das Finden eines Vorbildes kulturelles Vorwissen voraussetzt, das nicht jede:r hat. Zum anderen, weil ein entscheidender Faktor eines Vorbilds ist, dass man sich darin wiedererkennt und sich durch den Weg inspiriert fühlt. Der Anteil an weiblichen Wissenschaftlerinnen ohne akademischen Bildungshintergrund ist bisher jedoch gering.
Was muss sich deiner Meinung nach noch tun für Frauen in der Wissenschaft?
Grundsätzlich fehlt noch in vielen Bereichen der Wissenschaft die Einsicht, dass sich etwas tun muss. Wenn diese Einsicht und damit auch die Debatte darüber wächst, wäre der erste große Schritt getan.